Microsoft Fabric ist bequem – aber Bequemlichkeit hat ihren Preis
Microsoft Fabric gilt derzeit als die neue All-in-one-Lösung im BI-Universum. Eine Plattform, die Integration, Transformation und Reporting in einer Oberfläche vereint, mit dem Versprechen, endlich Schluss zu machen mit Datensilos, Systembrüchen und komplizierten Architekturen.


Für viele klingt das nach Erlösung
Gerade für Mittelständler mit begrenzten Ressourcen und überschaubarem Reportingbedarf scheint Fabric die Antwort auf eine alte Frage zu sein:
Wie modernisiere ich mein Reporting, ohne ein halbes Data-Team aufzubauen?
Fabric kann dafür sinnvoll sein. Aber nur, wenn man versteht, was man dafür bezahlt.
Warum Microsoft Fabric auf den ersten Blick überzeugt
Fabric adressiert ein reales Problem: Viele Unternehmen kämpfen mit fragmentierten BI-Landschaften, historisch gewachsenen ETL-Prozessen und fehlender Transparenz über ihre Datenflüsse. Microsoft hat das erkannt und in eine bequeme Oberfläche übersetzt:
• Einmal anmelden, alles integriert
• Power BI direkt verbunden
• Kein Infrastrukturaufwand
• Schnell sichtbare Ergebnisse
Für Organisationen mit fünf bis zehn Kernreports (z. B. Umsatz, Einkauf, Produktion oder Finanzen) kann das ein echter Fortschritt sein. Fabric senkt die Einstiegshürde und bringt Bewegung in festgefahrene Datenlandschaften.
Doch genau hier beginnt das Missverständnis.
Fabric löst kein Architekturproblem, es versteckt es
Technisch betrachtet ist Fabric kein neues System. Es bündelt bekannte Azure-Dienste (Data Factory, Synapse, Lakehouse und Power BI) in einer gemeinsamen Oberfläche. Das ist komfortabel, keine Frage. Aber Komfort ersetzt kein Architekturverständnis.
Man zahlt also nicht für neue Technologie. Man zahlt dafür, sie nicht verstehen zu müssen. Diese Bequemlichkeit hat mehrere Seiten:
• Finanziell
Lizenz- und Compute-Kosten liegen meist höher als bei modularen Setups.
• Strukturell
Die Abstraktion verhindert, dass internes Wissen über Datenmodelle entsteht.
• Strategisch
Je bequemer die Plattform, desto stärker die Bindung an den Anbieter.
Wie ein Nutzer auf Reddit treffend formulierte, sei Fabric schlicht:
„another way of Microsoft to generate vendor lock-in“
Kurz gesagt:
Fabric ist ideal für alle, die BI wollen, aber keine Architekturarbeit leisten möchten.
Der Preis der Bequemlichkeit
Fabric verkauft Integration. Doch Integration ist teuer. Denn im Hintergrund laufen dieselben Azure-Komponenten wie zuvor, nur stärker automatisiert und zentral verwaltet.
Ein Beispiel aus der Praxis:
In einem Machine-Learning-Projekt standen wir vor der Wahl, die Datenpipeline vollständig in Fabric zu bauen, oder das Backend manuell in Azure Databricks und Data Factory zu konfigurieren. Auf dem Papier war Fabric deutlich bequemer. In der Realität hätte die Total Cost of Ownership (TCO) auf Fabric-Seite jedoch fast das Vierfache betragen.
Der Grund:
Compute- und Storage-Kosten skalieren in Fabric automatisch mit, während man im modularen Setup Ressourcen gezielt steuern und optimieren kann.
Ein öffentlicher Kostenvergleich von Aimpoint Digital zeigt, dass ähnliche Szenarien „$915 für Azure Databricks gegenüber $8.409 für Fabric“ verursachen.
Also fast das Neunfache.
Unsere Entscheidung fiel deshalb klar für das individuell konfigurierte Backend – höherer Initialaufwand, aber langfristig kontrollierte Kosten und volle Architekturhoheit.
Hinweis:
Die tatsächlichen Kostenunterschiede hängen stark von Nutzung, Datenvolumen und Konfigurationsgrad ab. In typischen Szenarien für Mittelstands-Workloads zeigt sich jedoch ein ähnliches Muster: Je größer der Automatisierungsgrad, desto höher die langfristigen Betriebskosten.
Das ist völlig in Ordnung, wenn man weiß, dass man Bequemlichkeit kauft.
Problematisch wird es, wenn man glaubt, sie sei kostenlos.
Der Mittelstand und das Wunschversprechen
Gerade im Mittelstand fällt Fabric auf fruchtbaren Boden, oft aus psychologischen, nicht strategischen Gründen. Man will Komplexität vermeiden. Man fürchtet die Einstiegshürde moderner Datenarchitekturen. Und Fabric verkauft dafür eine elegante Abkürzung.
Doch wer seine Architektur auslagert, verliert mittelfristig Kontrolle:
• Kein Wissen über Datenflüsse bedeutet weniger Souveränität.
• Anpassungen werden teurer.
• Wachstum wird schwieriger.
Oder anders gesagt: Man spart heute Aufwand und zahlt morgen mit Abhängigkeit.
Wann Fabric trotzdem sinnvoll ist
Natürlich gibt es Fälle, in denen Fabric genau die richtige Wahl ist:
• Wenn kein dediziertes Data-Team vorhanden ist
• Wenn BI nicht geschäftskritisch, sondern unterstützend ist
• Wenn das Unternehmen bereits tief im Microsoft-Ökosystem steckt
• Wenn Reporting stabil, aber nicht strategisch differenzierend sein soll.
Dann ist Fabric ein pragmatischer Einstieg. Man kauft sich Stabilität, Wartungsfreiheit und eine schnelle Time-to-Value. Aber man sollte wissen: Es ist eine Abkürzung, kein Fundament.
Fabric-Versprechen vs. Realität
Wer glaubt, es löse strukturelle Probleme, verwechselt Bequemlichkeit mit Reife.
Die nachhaltigere Alternative: Kompetenz statt Komfort
Wer langfristig unabhängig, skalierbar und kosteneffizient bleiben will, kommt an Architekturkompetenz nicht vorbei. Das bedeutet:
• Eine saubere Semantik-Schicht, egal ob in Databricks, Fabric oder woanders
• Ein Governance-Framework mit dbt oder vergleichbaren Tools
• Eine klare Trennung zwischen Reporting, Transformation und Integration.
Ja, das erfordert mehr Aufwand. Aber das Wissen bleibt im Haus, und die Kontrolle ebenfalls.
Ein Inhouse-Teamlead Data Analytics brachte es kürzlich auf den Punkt:
“Fabric ist super bequem. Aber wer nur auf Bequemlichkeit setzt, versteht seine Daten irgendwann nicht mehr, sondern nur noch seine Rechnungen.”
Fazit: Bequemlichkeit ist keine Strategie
Fabric ist keine schlechte Lösung. Aber selten die günstigste, und noch seltener die nachhaltigste.
Für viele Mittelständler kann sie ein sinnvoller Startpunkt sein. Doch wer Daten nicht nur konsumieren, sondern verstehen will, kommt um echtes Architekturverständnis nicht herum.
Bequemlichkeit spart heute Zeit – aber Verständnis spart morgen Geld.

Wer versteht, entscheidet besser
Wir übersetzen komplexe BI-Architekturen in Klarheit, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle. Damit Technologie Ihre Strategie stärkt und nicht umgekehrt.
Kostenfreies Erstgespräch vereinbarenThomas Howert
Gründer und Business Intelligence Experte seit über 10 Jahren.
Weitere Artikel entdecken
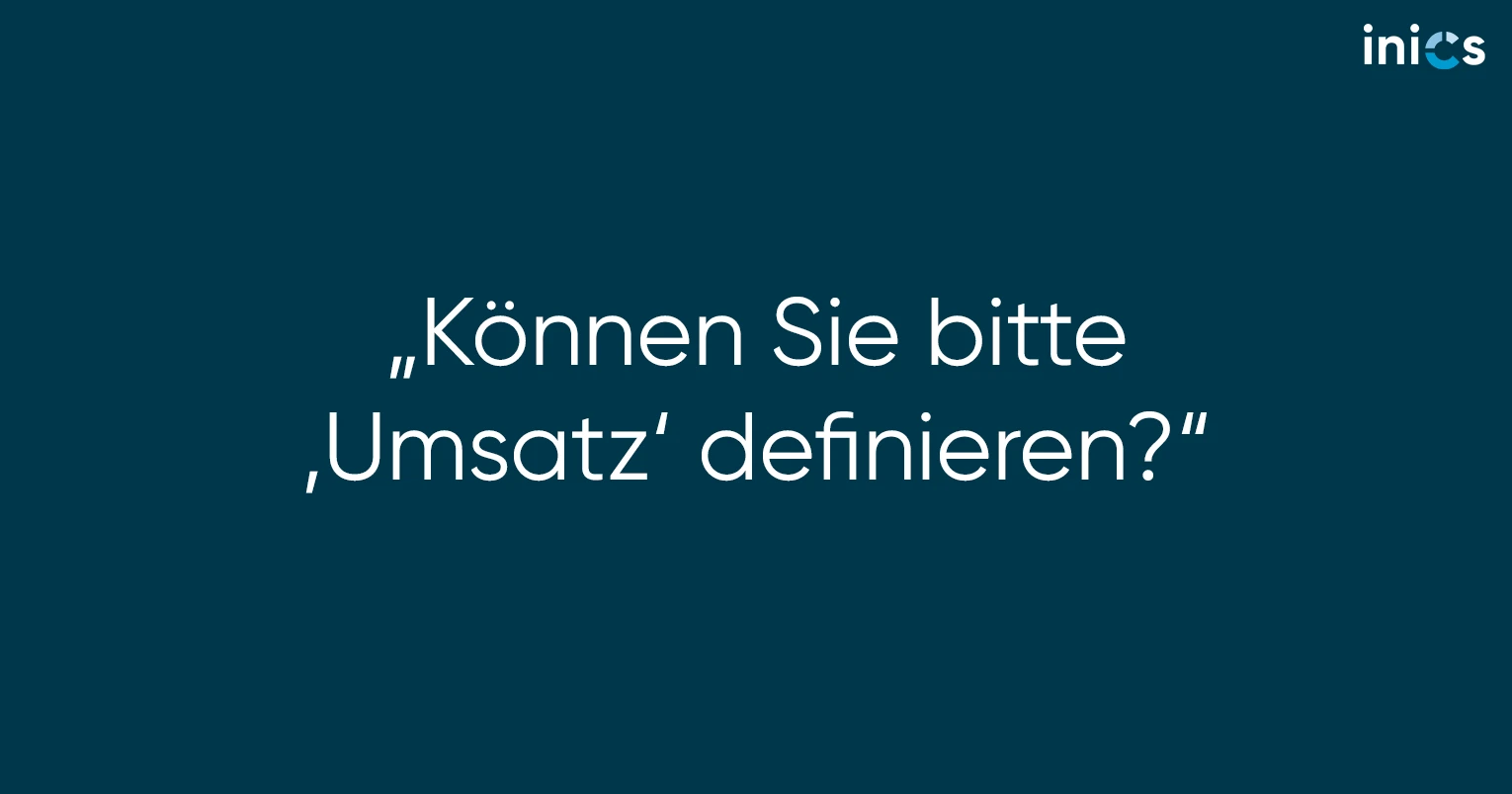
Data Governance und die Single Source of Truth
Oft treten Unternehmen an uns heran, weil ihr Reporting auseinander läuft. Dashboards widersprechen sich, KPIs sind inkonsistent, und fast immer wird die Ursache zuerst in der Technik gesucht.
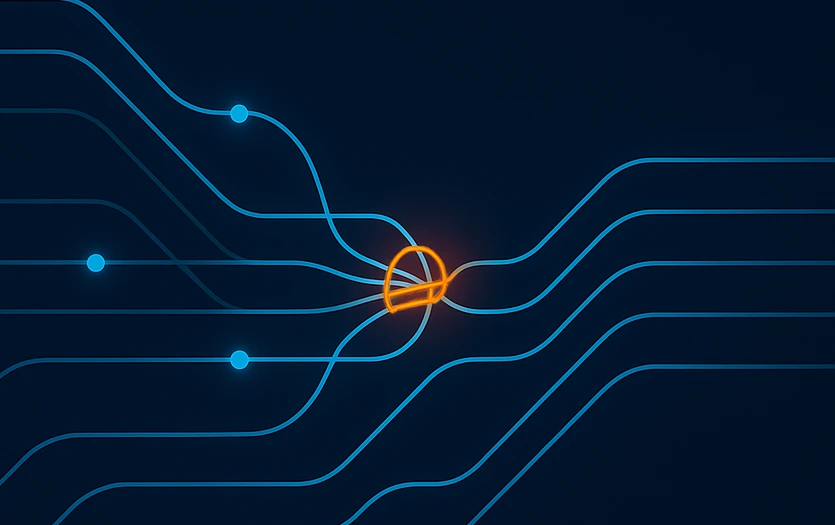
Critical Path Thinking: Datenpipelines wie ein Orchester dirigieren
Der CFO kümmert sich nicht darum, ob 200 Tabellen rechtzeitig neu geladen werden. Ihn interessiert, ob die GuV vor dem Board-Call bereitsteht. Das ist der Critical Path. Der Dirigent deiner Daten.

Daten sind entscheidend. Aber Menschen entscheiden.
Business Intelligence (BI) ist heute technologisch so stark wie nie. Plattformen wie Microsoft Fabric, Databricks und Qlik liefern integrierte Pipelines, Governance und KI-gestützte Insights in einer Dimension, die vor wenigen Jahren undenkbar war. Und trotzdem scheitern viele BI-Projekte. Nicht, weil die Daten unzuverlässig sind. Sondern, weil die menschliche Seite von BI zu wenig Beachtung findet. Hier ist die typische Leadership-Reise jeder BI-Initiative, und die Stellen, an denen sie ins Stocken gerät.
